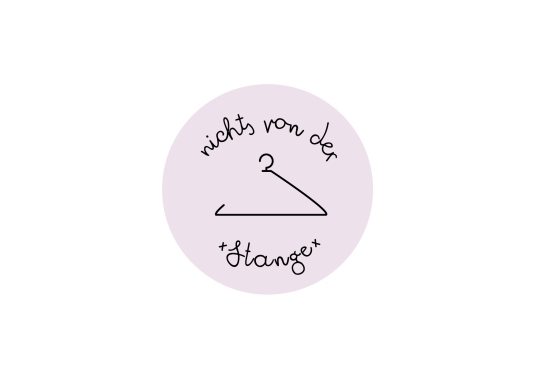Die Blumen blühen in voller Pracht, die Sonne strahlt mit den Gesichtern der Kinder um die Wette und die Eisdielen der Städte machen wieder den Umsatz Ihres Lebens: Der Sommer ist zurück. Und mit ihm die Sommerkleider und offenen Schuhe und Sonnenbrillen und Bikinis.
Klar, auch ich liebe es, wenn der Tag nicht durchgehend von Dunkelheit geprägt ist und man sein verkniffenes Bürogesicht in der Mittagspause in die Sonnenstrahlen recken und etwas entspannen kann. Besonders als Kind habe ich es genossen, in der puren Hitze nackt durch die Sonne zu toben und mich zwischendrin – zum Leidwesen der Kundschaft – an der Kühltheke des kleinen Supermarktes etwas akklimatisierte, indem ich meinen Po neben Joghurt und Milch platzierte.
Doch heute, einige Jahre später, sieht das ganz anders aus. Ich springe nicht mehr bei der ersten Hitzewelle nackt auf die Straße (okay, das hat inzwischen natürlich noch weitere Gründe) und suche eher die schattigen Plätzchen im Garten auf. Ja, heute ziehe ich den Winter vor!
Und so stehe ich im Büro und rufe: „Ich sehne mir so den Winter herbei!“ Ungläubige Gesichter starren mich an. „Johanna, erst gestern hast Du Dir Deinen Winterparka in der Agentur angezogen. Bei 22 Grad. Weil es Dir zu kalt war. Während der Rest von uns mit kurzärmeligen Shirts herumgelaufen ist“ entgegnet eine Kollegin. Und greift damit natürlich Tatsachen auf.
Klar, ich friere sehr schnell und auch sehr ungern und frage mich deswegen noch heute, wie ich damals die frostige Kühltheke im Supermarkt als angenehm empfinden konnte. Doch während der ein oder andere in Sandalen durch die Gassen flaniert, trage ich heute unter meinen Stiefeln am liebsten noch Mamas selbstgestrickte Socken. „Stimmt, aber trotzdem liebe ich den Winter so viel mehr“, erwidere ich. „Das Sommer-Winter-Feeling ist bei mir eben etwas verdreht“. „Naja, Du bist ja generell etwas verdreht, Johanna“; meint die Kollegin. Und ich mache so, als hätte ich es nicht gehört. Doch irgendwie stimmt es. Während gefühlt der Rest der Welt im Sommer leichte Speisen vorzieht, Salate anmacht, Gemüse mariniert und Beeren verputzt, bekomme ich in den sonnigsten Monaten Lust auf deftige, schwere Gerichte. Gerne darf bei mir mitten im Juli ein Gänsebraten mit Klößen auf den Mittagstisch. Und dann zum Nachtisch noch Mousse au Chocolat. Statt eines Wassereis‘ beim Sonnenbaden, genieße ich dann lieber dabei heiße Eintöpfe oder Suppen. „Du bist total verdreht“, meinte erst letztes Jahr meine Freundin Viki, als ich mir während einer Hitzewelle die zweite Portion Chili ganz frisch nachwürzte, während der Rest der Truppe vor Ihren Salaten mit Früchten saß und eher lustlos darin herumstocherte. Es ist auch schon irgendwie verdreht, dass ich im Sommer viel mehr Überwindung brauche, morgens aufzustehen um vor der Arbeit Joggen zu gehen. „Du weißt aber schon, dass es bei morgendlichem Sonnenschein und angenehmen 13 Grad leichter sein sollte?“ fragt mich mein Mitbewohner. Ja, ich weiß wie es eigentlich sein sollte. Bei mir ist es jedoch so, dass ich im tiefsten Winter bei 0 Grad morgens fast problemlos aus dem Bett springe, mir gefühlt 10 Schichten an Joggingklamotten überwerfe, dann den Schal, die Handschuhe, die Mütze und letztendlich – total vermummt – um 6 Uhr in die Dunkelheit trete. Dann, wenn die Kälte mir einen kleinen Schlag ins Gesicht verpasst und ich vor lauter Dunkelheit lediglich ahnen kannst, wo sich der Weg vor mir befindet…dann springen bei mir die Endorphine im Salto und ich empfinde pures Glück. Wohl das gleiche Glücksgefühl, das bei allen anderen während des Sonnenbadens am Strand, beim Eis essen im Park oder beim Freibad-planschen auftritt. Nur eben etwas verdreht.
Und so ist es doch kaum verwunderlich, dass ich nach Strandspaziergängen bei 30 Grad in Italien (und meinem obligatorischen deftigen Auflauf im Anschluss) doch gar nicht so entspannt bin. Nicht so wie Freunde und Familie, die in diesen Zeiten total aufblühen.
Eine ganze Weile hat mich das sehr irritiert und ich fragte mich:
„Warum ist das bei mir nur so verdreht?“
Und dann stand ich 2015 das erste Mal an einem Sommerurlaubsort nach meinem Geschmack. Oslo. 8 Grad. Starker Wind.
Und wie ich da so lief, bei Kälte, Nieselregen mit meinem grünen Schirm, kam Sie ganz plötzlich: Die Tiefen-Entspannung und Zufriedenheit.
„Wirklich seltsam“ dachte ich.
„Entschuldigung. Bei Ihnen ist da was verdreht“ meinte ein Passant freundlich und zeigte auf meinen Schirm, der sich- vor lauter Wind – etwas gelöst und um sich selbst gewickelt hatte.
„Stimmt! Bei mir ist da einfach etwas verdreht“ lachte ich.
Und freute mich, dass ich Sie endlich genießen konnte:
Meine verdrehten Glücksgefühle.
Meinen verdrehten Charakter.
Meine verdrehten Eigenschaften.
Und dann schmiss ich meinen verdrehten Schirm in den Müll und besorgte mir einen Neuen.
Naja.
Irgendwo hat auch die Verdrehtheit mal Grenzen.